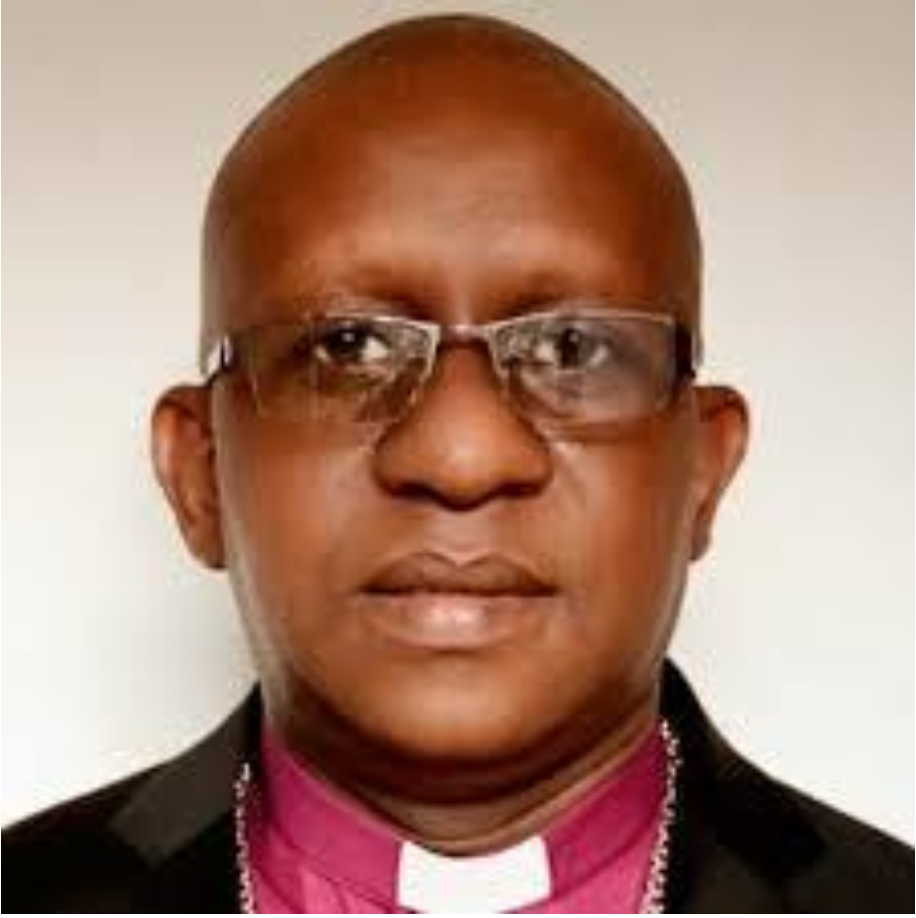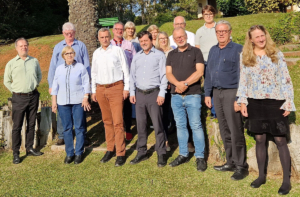Gemeinsam kochen verbindet: Die Süd-Nord-Freiwilligen von Mission EineWelt zusammen mit Vroni Heumann (r.) (Foto: Nadine Reinert)
Die erste Zeit nach ihrer Ankunft in Neuendettelsau haben die Süd-Nord Freiwilligen von Mission EineWelt genutzt, um gemeinsam mit Vroni Heumann, Küchenmitarbeiterin des BegegnungsCentrums, typische Gerichte aus ihren Heimatländern zu kochen.
„So eine große Auswahl an Gemüsesorten, wow!“, stellt Austin aus Liberia gleich zu Beginn ganz begeistert fest. Der Freiwillige schnappt sich eine Aubergine und mustert sie ausgiebig. „Das ist ein großer Luxus, den ihr in Deutschland habt. Bei uns zu Hause in Liberia essen wir nur einmal am Tag, und es gibt meist das gleiche Gericht, das alle von einem großen Teller essen. Jeden Tag wird Reis mit Bohnen zubereitet. Jeder isst mit der rechten Hand vom Teller, die Kleinen müssen ganz schnell sein. Denn wer schnell isst, bekommt auch mehr.“ Als Austin ausgiebig von seiner Heimat erzählt und Fotos von hungrigen Kindern zeigt, schauen alle bedrückt. Auch Vroni Heumann hört gebannt zu, während sie gemeinsam mit den Jugendlichen Gemüse schnippelt und das Tapiokamehl für das erste Gericht mit Wasser und Öl mischt.
Die Süd-Nord Freiwilligen kommen 2024 neben Liberia aus Papua-Neuguinea, Paraguay, China, Brasilien und Nicaragua. Für ein Jahr arbeiten sie als Bundesfreiwillige in verschiedenen Einsatzstellen bayernweit mit, zum Beispiel in Kindergärten. Noch verständigen sie sich auf Englisch. Nur die Freiwillige aus Brasilien spricht kein Englisch, kann dafür aber gut Deutsch.
Das erste Gericht, das gekocht wird, hat Natanielly aus Brasilien mitgebracht: Pão de Quejo. Die Käsebällchen sind in Brasilien sehr beliebt. Als die runden Bällchen aus dem Ofen kommen und alle davon probiert haben, wissen sie, warum.
Natanielly erzählt, dass es bei ihr zu Hause in Brasilien auch oft Reis mit Bohnen gibt. Fleisch ist in Brasilien sehr teuer. Es kommt ein- bis zweimal pro Woche auf die Teller.
Austin aus Liberia ist zwischenzeitlich mit dem Schnippeln des Gemüses für sein Gericht fertig: Er bereitet eine Auberginen-Suppe mit Reis und Hühnchen zu. Zum Würzen des Fleisches möchte er gerne acht Chili Schoten mit Kernen verwenden, außerdem scharfe Gewürze. Vroni Heumann erklärt ihm, dass das für die anderen Freiwilligen wahrscheinlich zu scharf werden könnte und jagt nur 2 Chilischoten ohne Kerne durch den Häcksler. Wie sich am Ende herausstellt, ist das bei weitem scharf genug. Alle probieren und reißen die Augen auf. Aber schnell stellt sich Begeisterung ein, das Essen schmeckt allen. Besonders Stella aus Paraguay kann gar nicht damit aufhören, das Essen zu loben: „Das schmeckt einfach so gut, das ist so gut!“ Sie bittet mehrmals um einen Nachschlag. Vroni Heumann muss ein wenig bremsen: „Wir möchten doch erst mal von jedem Essen probieren – am Ende darf sich dann jede und jeder so viel nehmen, wie er oder sie möchte. Aber lass‘ uns jetzt erst mal zu deinem Gericht kommen!“

Zusammenhelfen verbindet: Stella (l.) und Tiffany (l.) beim Reiskochen (Foto: Nadine Reinert)
Also zeigt Stella aus Paraguay nun den anderen, wie sie zu Hause „Vori Vori“ kocht. Bis alle das Gericht richtig aussprechen können, haben sie einen Riesenspaß. Immer wieder singen sie und freuen sich über das Zusammensein. In den ersten vier Wochen nach der Ankunft in Deutschland besuchen die Süd-Nord Freiwilligen die Sprachschule und sind sehr mit dem Lernen der neuen Sprache beschäftigt. Zeit, zusammen zu kochen, hatten die Jugendlichen noch keine. Umso mehr genießen sie deshalb ihre Freizeit und das Kennenlernen der verschiedenen Gerichte. Auch die ersten negativen Erfahrungen tauschen sie aus, zum Beispiel, dass man schon mal angeschrien wird, wenn man unterwegs einfach drauflos fotografiert und nicht darauf achtet, ob andere Menschen mit auf dem Foto abgebildet sind. Währenddessen wird Stellas Suppe fertig. Alle probieren und sind begeistert, wie toll Stella kochen kann und wie gut „Vori Vori“ schmeckt.
„In Paraguay essen wir sehr viel Fleisch. Jeden Sonntag gibt es nach dem Gottesdienst ein Barbeque mit der ganzen Familie, das ist unser Highlight der Woche. Ich liebe das gemeinsame Grillen und Essen!“, erzählt Stella. Essen verbindet eben.
Als nächstes ist Kaiyun aus China dran. Kevin, wie er sich selbst nennt, zeigt erst Bilder von „1.000-jährigen Eiern“ und erklärt, dass diese in Wirklichkeit natürlich nicht 1.000 Jahre alt sind. Die Eier werden speziell zubereitet und sind in China eine Spezialität. „Bereits zum Frühstück essen wir eine warme Suppe. Da kann dann auch zum Beispiel ein Ei drin sein“, sagt Kevin. Die anderen Freiwilligen schauen gebannt, als Kevin Fotos von weiteren typischen chinesischen Gerichten zeigt. Während er gebratenen Reis zubereitet, schauen ihm Vroni und Stella über die Schulter und sind begeistert von Kevins Kochkünsten. „Du bist ja ein richtiger Koch! Ich glaube, Du kannst ab sofort jeden Tag für uns alle kochen!“, lacht Stella. Als der gebratene Reis mit Gemüse auf dem Tisch steht, können sich die anderen kaum halten vor Begeisterung.

Haben viel Spaß beim gemeinsamen Kochen: die Süd-Nord-Freiwilligen Tiffany, Douglas, Kevin und Austin (v.l.n.r.) (Foto: Nadine Reinert)
Das letzte Gericht kochen Tiffany und Douglas aus Papua-Neuguinea (PNG). Tiffany erzählt, dass in PNG nur die Frauen kochen. Daher ist es für die junge Frau sehr ungewohnt, zusammen mit Douglas Gemüse zu schneiden. Der allerdings schnippelt Gemüse, als würde er das seit Jahren mehrmals täglich machen. Es gibt Reis mit Gemüse. Bei ihr zu Hause werde nur frisches Gemüse aus dem eigenen Garten verwendet, sagt Tiffany. Dazu gebe es häufig Süßkartoffeln, und auch Fisch lande häufig auf dem Teller – zumindest in den Küstenregionen. Auch das Essen aus PNG ist sehr gut gelungen und bekommt jede Menge Lob.
Nach dem Kochen und Probieren heißt es nun für alle: Nehmt Euch von allen Gerichten, was und so viel Ihr wollt. Das lassen sich die Freiwilligen nicht zweimal sagen. Essen aus fünf Ländern auf einem Teller – Douglas ist fasziniert: „Käsebällchen aus Brasilien, Auberginensuppe aus Liberia, Vori Vori aus Paraguay, gebratener Reis aus China und Reis mit Gemüse aus PNG! – Wow, seht Euch das an!“ Auch die anderen Freiwilligen genießen ihr Essen und sind dankbar für den gemeinsamen Abend, das gemeinsame Kochen, die Geschichten und das freundschaftliche Ambiente.
Sie bedanken sich bei Vroni Heumann und betonen, wie wertvoll es für sie sei, dass sie im BegegnungsCentrum mit so viel Freundlichkeit empfangen werden. Plötzlich steht Austin auf, reibt sich den Bauch, schließt die Augen und sagt: „Mmmmmmmh! Das war so gut, das Essen schmeckt so toll. Ich bin überaus dankbar. Ich möchte mich bei euch bedanken, von ganzem Herzen. Bei uns zu Haus drückt man Dankbarkeit so aus – ich zeige es euch!“ Er geht zu Vroni Heumann, verneigt sich vor ihr, gibt ihr die Hand und sagt: „Danke, Vroni! Ich danke dir von Herzen!“. Die tiefe Dankbarkeit ist noch lange zu spüren bei den Gesprächen im Laufe des Abends.
Nadine Reinert
Hinweis:
Im August und September läuft die Reihe „Kulinarische Weltreise“ auf den Social Media-Kanälen von Mission EineWelt:
Instagram: @mission_einewelt, @ief.programm, @pazifik_infostelle und @erlanger_verlag
Facebook: @Mission EineWelt, @Pazifik-Informationsstelle